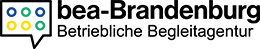Eine Handvoll Fragen zur Integration durch Bildung und Beratung
Wir sprachen mit Diana Gonzalez-Olivo, Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg, über Bildung und Teilhabe für und von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte und deren Einbettung in kommunale Bildungslandschaften.
Dabei wird deutlich: Es braucht differenzierte Bildungsangebote, die Lebensrealitäten und Kompetenzen anerkennen, Zweitspracherwerb alltagsnah ermöglichen und migrantische Perspektiven sichtbar machen. Gonzalez Olivo betont insbesondere die Rolle von Migrant*innen-Organisationen als Brückenbauerinnen und Impulsgeberinnen in kommunalen Bildungsprozessen. Entscheidend sei, bestehende Barrieren – etwa bei der Anerkennung von Kompetenzen – abzubauen und kulturelle Ressourcen als Teil des Bildungserfolgs zu verstehen. Nur so kann Teilhabe auf Augenhöhe gelingen und das Potenzial der Migrationsgesellschaft in Brandenburg wirksam werden. Sie macht insgesamt deutlich: „Es geht um Empowerment und Selbstwirksamkeit in allen Lebensbereichen!“
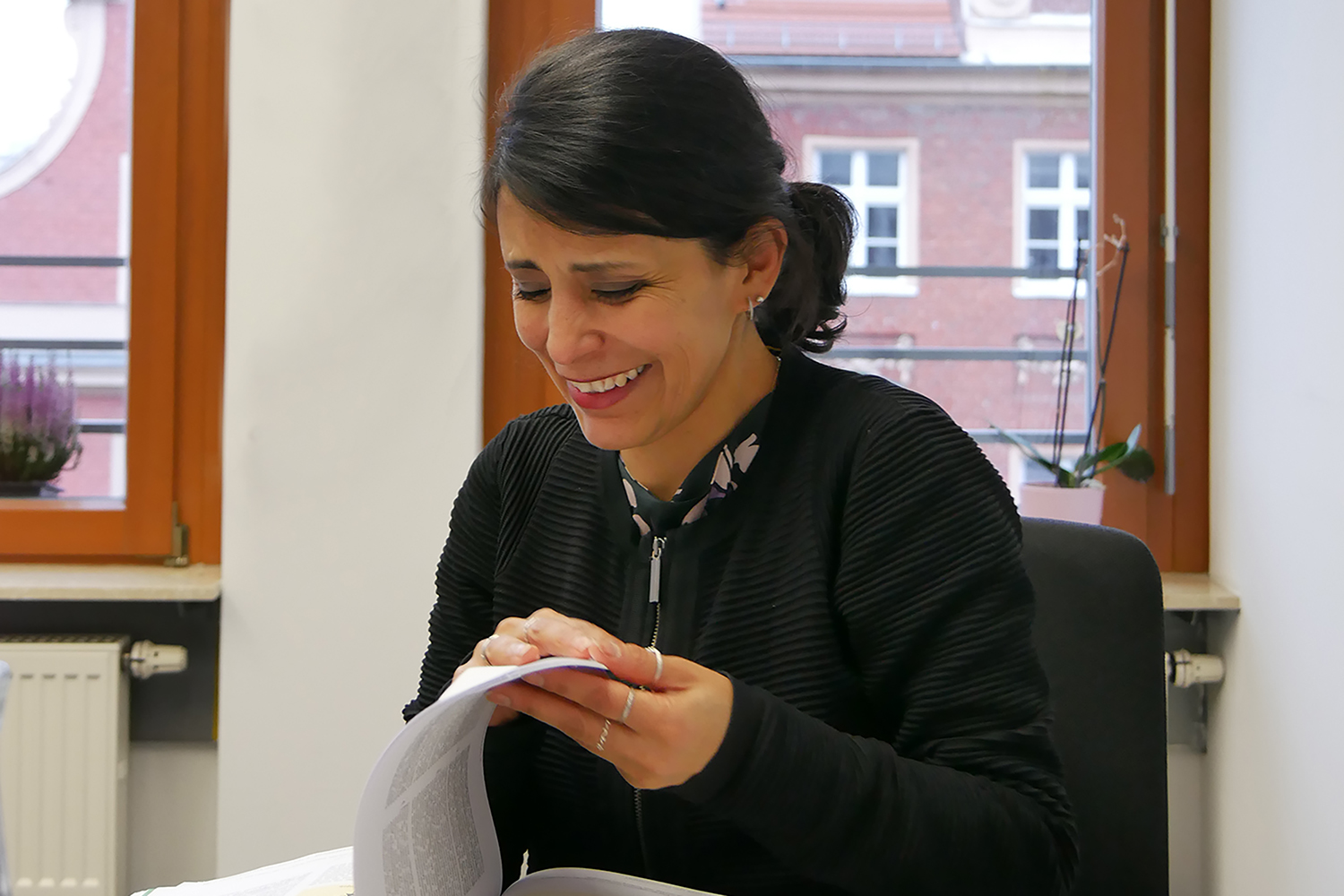
Kommunen
stärken
Impulse
geben
Vernetzung
fördern
1. Frau Gonzalez Olivo, was sind aus Ihrer Sicht hilfreiche Bildungsangebote, die die Integration und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte fördern?
Welche Bildungsangebote tragen zum Zusammenwachsen unserer Migrationsgesellschaft bei?
Man muss bei der Herausforderung, hier in Deutschland als geflüchteter Mensch Fuß zu fassen, zwischen unterschiedlichen Neustartbedingungen von Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund differenzieren. Die Unterschiede bedingen, wie herausfordernd der Prozess verläuft und was bei der Integration hilfreich ist. Deshalb gibt es kein Patentrezept für Bildungsangebote, die für alle unterschiedlichen Alterskohorten, Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen, Menschen mit und ohne Deutschkenntnissen gleichermaßen gelten. Für Erwachsene ohne formale Ausbildung, die jenseits des typischen Ausbildungsalters liegen und gezwungen waren, ihr früheres Leben hinter sich zu lassen, ist es deutlich schwerer, in Deutschland Fuß zu fassen als für junge Menschen, die noch einen Teil des Bildungs- sowie das Ausbildungssystems durchlaufen können.
Die Kompetenzen, die Erwachsene ohne formale Ausbildung in ihrem bisherigen Erwerbsleben vor der Flucht selbstverständlich erworben haben, sind ebenso wertvoll für den deutschen Arbeitsmarkt. Die Frage ist nur, wie diese Kompetenzen in unserem Bildungssystem und dessen vergleichsweise stark geregelten Anerkennungsverfahren Einklang finden können und wie das Potenzial dieser Menschen erkannt und altersunabhängig in die passenden Bereiche gelotst werden kann. Ich sehe hier eine Lücke, die auf Basis eines kompetenzorientierten Blicks geschlossen werden müsste, um den Menschen auf ihrem Weg in eine Erwerbstätigkeit passgenaue Möglichkeiten zu eröffnen.
2. Welche Bildungsangebote sind aus Ihrer Perspektive für eine gelingende Ausbildungs- und Arbeitsmarktintegration besonders wirksam? Haben Sie ein Good Practice-Beispiel für uns?
Dafür, dass in migrantischen Communities Transparenz über Bildungsketten in Deutschland sichergestellt wird und Übergänge von der Schule in den Beruf bestmöglich begleitet werden, engagieren sich die Mitarbeiter*innen der KAUSA-Landesstelle Brandenburg für Ausbildung und Migration. Dazu, wie es gelingen kann, Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung in den Betrieb zu integrieren, berät zudem die Betriebliche Begleitagentur bea-Brandenburg. Hier gibt es Bildungsangebote u.a. zum Zweitspracherwerb, zur Kulturvermittlung und zur interkulturellen Kommunikation in betrieblichen Teams, die Teil der kommunalen Bildungslandschaft sind. Darüber hinaus sind Sprachbildungsangebote vor Ort sehr wichtig.
Die Forderung nach einer schnelleren Arbeitsmarktintegration kann ich nachvollziehen, umso mehr wird es auf die Möglichkeiten ankommen, berufsbegleitend am Zweitspracherwerb arbeiten zu können. Wer eine schnellere Arbeitsmarktintegration fordert, muss daran denken, dass die deutsche Sprache nicht von selbst kommt. Im beruflichen Kontext kann die Sprachbildung praxisorientiert-fachsprachlich erfolgen. Die bea-Brandenburg könnte hier verschiedene Beispiele nennen. Letztlich ist der Zweitspracherwerb ein individueller Prozess.
3. Ist Deutsch die einzige praktikable Arbeitssprache und Voraussetzung für die Integration in den Arbeitsmarkt oder braucht es hier mehr Offenheit und Flexibilität seitens der Arbeitgeber*innen?
Jenseits von globalen Berufsfeldern braucht es Toleranz dafür, sich auch auf Englisch zu verständigen. Das ist eine Realität in einer globalisierten Welt. Deutschland öffnet viele Türen, aber die Fokussierung auf das Beherrschen der deutschen Sprache als Voraussetzung für Bildung und Teilhabe auf unterschiedlichen Ebenen ist in vielen Bereichen ein Exklusionsfaktor. Ich sage zwar immer „lerne Deutsch“, aber es gibt Bereiche, in denen das kollegiale Umfeld eine Toleranz, Verständnis und Fremdsprachenkompetenz hat, um die Kommunikation im Berufsalltag aufeinander abzustimmen. Dabei muss niemand perfekt sein. Man sollte sich möglichst von der übertriebenen Erwartung befreien, fehler- und akzentfrei zu sprechen.
Je einfacher die Aufgaben eines Tätigkeitsfeldes sind, desto weniger Deutschkenntnisse sind dafür erforderlich, sodass der Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht zu sehr an den deutschen Spracherwerb geknüpft sein sollte. Gleichzeitig sollte man den Arbeitnehmer*innen gute Chancen dafür eröffnen, alles dafür zu tun, dass nachfolgende Generationen bessere Zugänge haben.
4. Der Erwerb des Deutschen als Zweitsprache ist ein Weg, um in unserer Migrationsgesellschaft und in den meisten Berufsfeldern anzukommen. Gleichzeitig zielt die Teilhabe an kommunalen Bildungslandschaften auf die wertschätzende Chance, das kulturelle Erbe der Migrant*innen als Kulturkapital zu erhalten.
Wie denken Sie darüber, migrantischen Communities die Chance zu geben, in kommunalen Bildungslandschaften ihr Kulturkapital zu erhalten und Angebote dafür sichtbar zu machen?
Beim Thema Mehrsprachigkeit ist es immer noch so, dass es eine große Hierarchisierung der Sprachen gibt. Ich habe mit Spanisch als Herkunftssprache Glück. Spanisch wird in den weiterführenden Schulen auch als Fach angeboten und die Sprache wird gern und auch fließend von vielen Brandenburger*innen gesprochen. Wer Arabisch als Herkunftssprache hat, hat es hingegen nicht leicht. Es kursiert noch immer der Irrglaube, dass es sich negativ auf das Erlernen der deutschen Sprache auswirkt, wenn Kinder aus migrantischen Familien zuhause nur in der Herkunftssprache reden. Es ist jedoch erwiesen, dass eine gute Konversation mit den Eltern in ihrer Herkunftssprache besser ist als schlechtes Deutsch.
Mehrsprachigkeit wird hierzulande in der Regel ein größerer Wert beigemessen, wenn es Englisch, Spanisch, Russisch oder Französisch ist. Wenn die Herkunft- oder Erstsprache jedoch positiv besetzt und als Ressource erlebt werden kann, könnten wir auch die Vielfalt leichter zusammenbringen. Es würde die Selbst- und Fremdwahrnehmung von Menschen mit Flucht- und Migrationsbiografie positiv verändern. Ich finde schon, dass es zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen kann, wenn ich das als einen Teil von mir akzeptieren und auch so leben kann.
Es gibt viele biografische Geschichten aus der postmigrantischen Generation, aus vietnamesischen Familien beispielsweise, deren Eltern als ehemalige Vertragsarbeiter*innen der DDR nach der Wende sich ihre Integration durch Fleiß und Anpassung erkämpft haben. Ihre Kinder finden inzwischen immer stärker zurück zu ihren kulturellen Wurzeln und zu ihrer Familiensprache. Sie wollen nicht mehr nur die leisen und vorbildlich assimilierten Migrant*innen sein. All das, was sie durchgemacht haben an Exklusion und Rassismuerfahrungen, darüber wurde lange nicht gesprochen, sondern es wurde umgedichtet in „supervorbildlich“ und „unauffällig“. Doch jetzt kommen ihre Kinder und finden ihre eigene Stimme und schaffen eine Sichtbarkeit, die vorher so nicht da war.

© kobra.net
5. Ein Weg, den Menschen eine Stimme zu geben, ist die Beteiligung von Migrant*innen-Organisationen an der Gestaltung kommunaler Bildungslandschaften. Wie kann das gelingen?
Migrant*innen-Organisationen sind wichtige Impulsgeber*innen, die oft auch eine beratende und begleitende Rolle übernehmen. Ihr Ursprung liegt im Empowerment für Migrant*innen. Am Beispiel der vietnamesischen Organisationen und Vereinigungen in Brandenburg, die sich nach der Wende gegenseitig unterstützt haben, wurden sukzessive Hilfsnetzwerke entwickelt. Auf Treffen von Migranten*innen-Organisationen geht es generell nicht nur darum, schön zu essen und bestimmte Feste gemeinsam zu feiern, sondern auch um Austausch über aktuelle Themen, zu denen die Personen einen Rat oder eine Empfehlung brauchen. Im geschützten Rahmen können Fragen gestellt und Erfahrungen ausgetauscht werden, so tauscht man sich beispielsweise darüber aus, wie das Bildungssystem funktioniert; wie man nach Erziehungszeiten am besten wieder zurück in den Arbeitsmarkt findet; wie die Anerkennung der Zeugnisse funktioniert oder wie Familiennachzug funktioniert. Sie teilen informell Empfehlungen über hilfreiche Ansprechpartner*innen, zeigen aber auch Wege auf, wie man z.B. einen Verein gründen kann. Die Themen sind sehr vielfältig und die Entwicklung der Migrant*innen-Organisationen ganz unterschiedlich. Manche haben sich zum Teil professionalisiert und Beratungsstrukturen mit speziellen Schwerpunkten geschaffen.
Besonders hilfreich ist generell, dass Menschen sich in diesen Organisationen in ihrer Herkunftssprache einen Überblick verschaffen können, ohne dass es „dumme“ Fragen gibt. Von daher finde ich schon, dass sie superwichtige Netzwerk- und Ansprechpartner*innen für neu zugewanderte Menschen sind, aber eben auch für die Mitarbeiter*innen in kommunalen Bildungsbüros, wenn es um die Erreichbarkeit der Zielgruppe für relevante Bildungsangebote oder um die Beteiligung bei der Schaffung zielgruppenspezifischer Bildungsangebote vor Ort geht. Meine Vorgängerin, Frau Dr. Lemmermeier, hat die Möglichkeit der Förderung geschaffen, damit Ehrenamtliche in solchen Organisationen eine Grundausstattung haben können und arbeitsfähig sind, z.B., Arbeitsräume und Equipment für ihr Engagement. Ziel ist, dass sie die Chance haben, sich in unterschiedlichen Bereichen zu professionalisieren. Letztendlich geht es um Empowerment und Selbstwirksamkeit in allen Lebensbereichen.